Meilensteine der Energiewende
Wie energetische Standards den Weg zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz ebnen
Beitrag von Moritz Brembs, Bildungsmanager der Handwerkskammer für München und Oberbayern
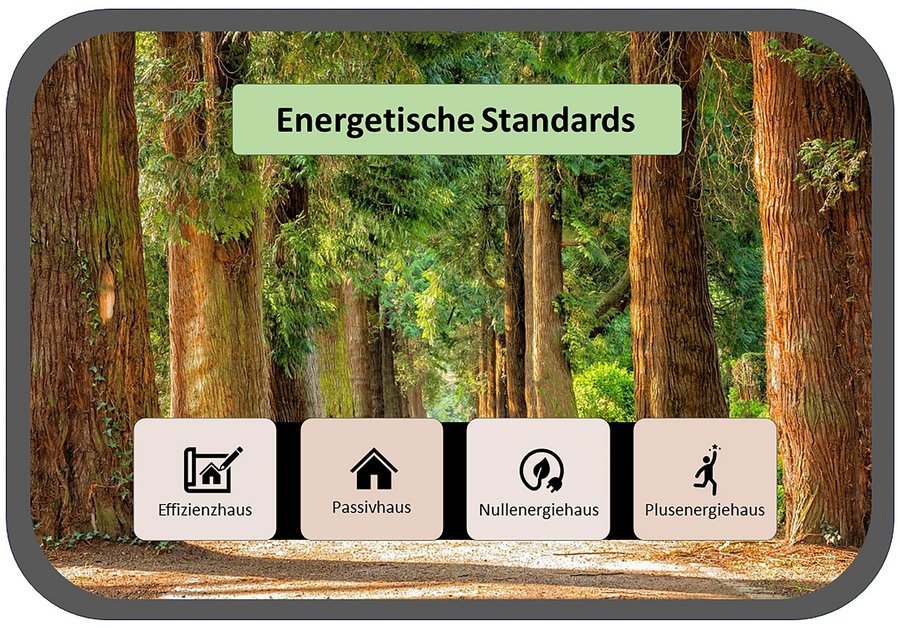
Energetische Standards sind wesentliche Leitplanken in der Architektur und beim Bauen, die darauf abzielen, den Energieverbrauch von Gebäuden zu minimieren und somit einen entscheidenden Beitrag zum Schutz des Klimas zu leisten.
Energetische Standards definieren technische Spezifikationen und Kriterien, die Bauwerke erfüllen müssen, um als energieeffizient, umweltfreundlich oder nachhaltig zu gelten. Sie reichen von Vorgaben zur Minimierung des Heiz- und Kühlbedarfs über den Einsatz erneuerbarer Energien bis hin zu ganzheitlichen Konzepten für nachhaltiges Bauen. Im Folgenden werden einige bekannte energetische Standards dargestellt.
Effizienzhaus
Der KfW-Effizienzhaus-Standard ist ein in Deutschland etablierter Standard für energieeffizientes Bauen. Er wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergeben und stuft Gebäude anhand ihres Energiebedarfs in verschiedene Kategorien ein. Je niedriger deren Zahl, desto energieeffizienter ist das Gebäude. Die Effizienzhaus-Stufen orientieren sich am sogenannten Referenzgebäude, einem fiktiven Gebäude, das den Mindestanforderungen an den Energieverbrauch nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) entspricht. Der Energiebedarf des Effizienzhauses wird im Vergleich zum Referenzgebäude berechnet. Ein zentraler Aspekt der Effizienzhäuser ist nicht nur die Begrenzung des Primärenergiebedarfs – also der Energie, die für Heizung, Warmwasser, Beleuchtung und weitere gebäudetechnische Anlagen unter Berücksichtigung von Energieumwandlungsverlusten benötigt wird – sondern auch die Reduzierung des Transmissionswärmeverlusts. Letzterer beschreibt den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle und ist ein wesentlicher Faktor für die Energieeffizienz. Darüber hinaus wird auch der Nutzenergiebedarf, der für die Beheizung und Kühlung von Räumen sowie für die Warmwasserbereitung erforderlich ist, streng limitiert.
Passivhaus
Das Passivhaus ist einer der strengsten Standards für Energieeffizienz. Ein Passivhaus zeichnet sich durch seinen minimalen Heiz- und Kühlenergiebedarf aus, was hauptsächlich durch eine exzellente Wärmedämmung, eine luftdichte Gebäudehülle und eine effiziente Lüftung mit Wärmerückgewinnung erreicht wird. Passive Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung und Abwärme von Bewohnern oder technischem Gerät spielen ebenfalls eine Rolle. Dieser Standard reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung um bis zu 90% im Vergleich zu herkömmlichen Neubauten. Der Heizenergiebedarf um ein behagliches Innenklima ohne Klimaanlage und separates Heizsystem zu erreichen, ist festgelegt auf maximal 15 kWh/(m2a). Das Passivhaus Institut gibt die zulässigen Kennwerte für Kriterien wie die Luftdichtheit, Lüftungswärmerückgewinnung, Wärmedämmung und Bauteilqualitäten vor. Der Bedarf an erneuerbarer Primärenergie ist dabei auf maximal 60 kWh/(m2a) begrenzt.
Sanierung mit PassivhausKomponenten: Der EnerPHit-Standard
Nicht jedes Gebäude kann von Grund auf als Passivhaus gebaut werden. Hier kommt der EnerPHit-Standard ins Spiel, der speziell für die Bestandssanierung entwickelt wurde. Trotz Herausforderungen wie unvermeidbaren Wärmebrücken oder einer ungünstigen Gebäudeausrichtung ermöglicht dieser Standard durch die Verwendung passivhaustauglicher Komponenten eine signifikante Verbesserung der Energieeffizienz. Die Dämmung von Kellerdecke, Außenwänden und Dach mit passenden Dämmstoffdicken und effizienten Materialien ist hierbei zentral. Das unabhängige Passivhaus-Institut zertifiziert Bauteile nach Produktprüfung anhand einheitlicher Kriterien hinsichtlich deren Eignung für den Einsatz in Passivhäusern. Planer können auf Datenbanken dieser zertifizierten Passivhaus-Komponenten zurückgreifen, um so den EnerPHit-Standard umzusetzen.
Nullenergiehaus und Plusenergiehaus
Ein Nullenergiehaus hat eine ausgeglichene Energiebilanz, was bedeutet, dass es über das Jahr gerechnet so viel Energie erzeugt, wie es verbraucht. Dies wird durch eine Kombination aus hoher Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien wie Solarenergie erreicht. Ein Plusenergiehaus deckt nicht nur seinen eigenen Energiebedarf, sondern speist überschüssige Energie zurück ins Netz. Diese Gebäude sind wahre Kraftwerke der Nachhaltigkeit und stehen für eine Zukunft, in der Gebäude aktiv zum Umweltschutz beitragen.
Technische Grundlagen und Anforderungen
Einer der zentralen Aspekte energetischer Standards ist die Optimierung der thermischen Hülle von Gebäuden. Hierzu zählt die Verbesserung der Dämmung von Wänden, Dächern und Böden sowie die Vermeidung von Wärmebrücken, die zu Wärmeverlusten führen können. Innovative Dämmmaterialien wie Vakuumisolationspaneele oder Aerogele bieten hier neue Möglichkeiten, auch in der Sanierung bestehender Gebäude, um hohe Dämmwerte auf geringem Raum zu erzielen.
Die Gewährleistung einer adäquaten Luftdichtheit ist entscheidend, um unkontrollierte Luftströme zu vermeiden, die den Heiz- oder Kühlbedarf erhöhen.
Gleichzeitig muss eine kontrollierte Lüftung sichergestellt sein, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung sind hier besonders effektiv, da sie die Energie aus der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen.
Die Integration erneuerbarer Energietechnologien ist ein weiterer wichtiger Punkt energetischer Standards. Solarenergie, sei es durch Photovoltaik oder solarthermische Anlagen, sowie Wärmepumpensysteme, die Umgebungswärme nutzen, spielen eine zentrale Rolle. Ingenieure stehen vor der Aufgabe, diese Systeme effizient in bestehende Gebäudestrukturen zu integrieren und dabei auch Speicherlösungen für eine konstante Energieversorgung zu berücksichtigen.
Herausforderungen und Perspektiven
Die Umsetzung energetischer Standards bringt verschiedenen Herausforderungen mit sich, darunter höhere Anfangsinvestitionen und der Bedarf an spezialisiertem Wissen und Technologien. Dennoch bieten sie eine vielversprechende Möglichkeit, den Übergang zu einer nachhaltigeren und energieeffizienteren Gesellschaft zu gestalten. Auch Gebäudenutzern bieten strenge Standards wie der Passivhausstandard eine Reihe greifbarer Vorteile. So wird durch sie die thermische Behaglichkeit verbessert, Feuchtigkeit und Schimmelbefall in der Konstruktion vermieden und die Wertigkeit des Gebäudes erhöht.
Energetische Standards bieten Ingenieuren zudem eine Plattform für Innovationen und technische Exzellenz in der Gebäudesanierung. Durch die Vertiefung in die technischen Details dieser Standards können Ingenieure nicht nur zur Energieeffizienz von Gebäuden beitragen, sondern auch den Komfort und die Lebensqualität für Nutzer verbessern. Die Auseinandersetzung mit und Anwendung von energetischen Standards zwingt, über traditionelle Lösungen hinauszudenken und neue, innovative Technologien und Methoden zu entwickeln und einzusetzen. Dies eröffnet Möglichkeiten, die Effizienz von Sanierungsprojekten zu steigern, die Betriebskosten zu senken und einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Quellen
Passivhaus Institut. (o. D.). Energiestandards. Abgerufen am 24. März 2024, von passiv.de/de/03_zertifizierung/02_ zertifizierung_gebaeude/04_enerphit/04_ enerphit.htm
Neubau: Was ist ein Effizienzhaus? | KfW. (o. D.). KfW Bankengruppe. www. kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/ Neubau/Das-Effizienzhaus/
Was ist ein Passivhaus? [Passipedia DE]. (o. D.). passipedia.de/grundlagen/ was_ist_ein_passivhaus
IG-Passivhaus / Informations-Gemeinschaft Passivhaus Deutschland. (2024, 24. März). www.ig-passivhaus.de
Erstmals erschienen in: TiB Ausgabe 04/2024 JUL/AUG
